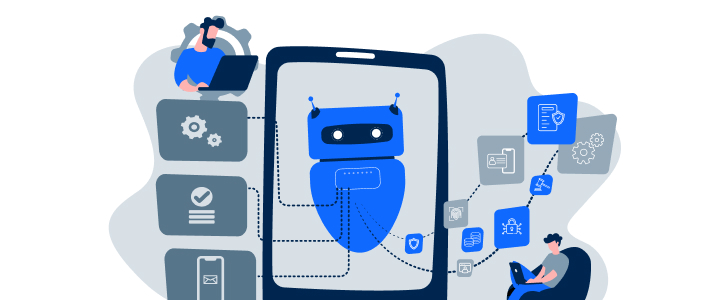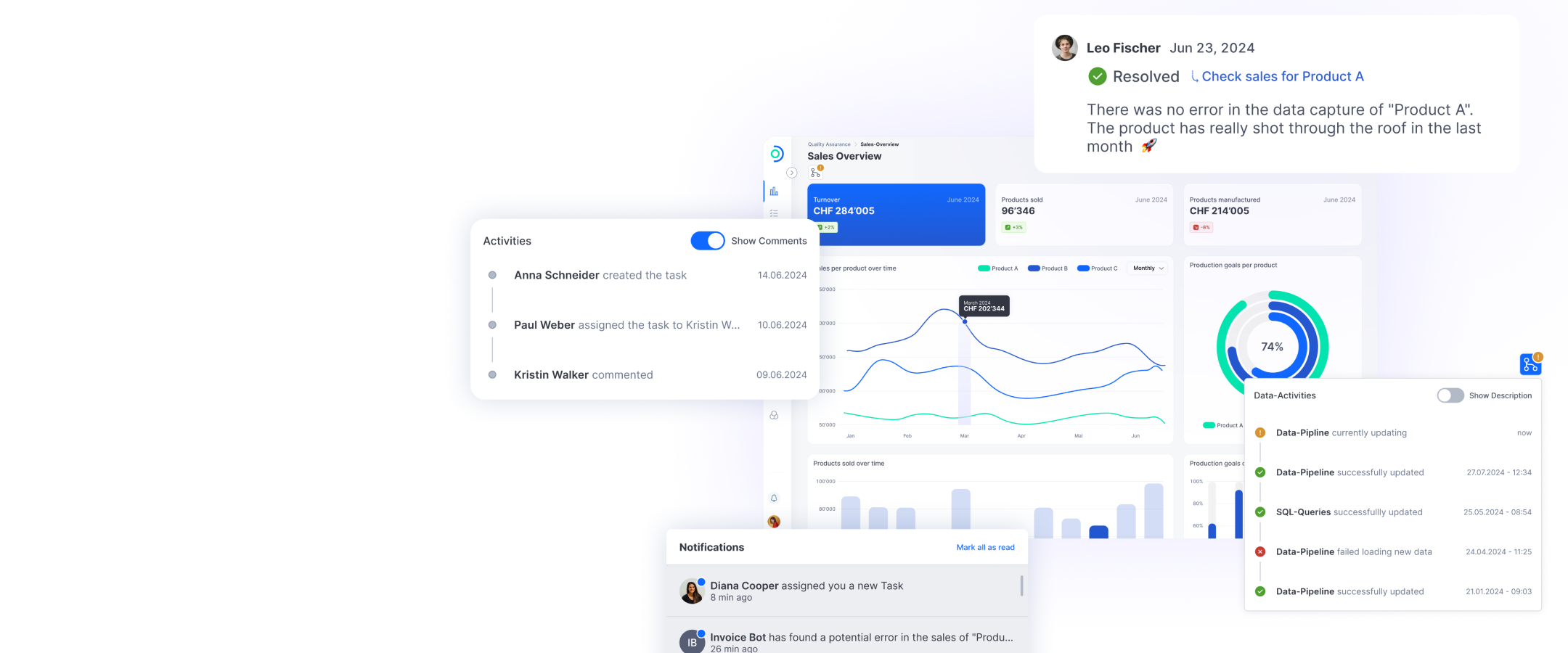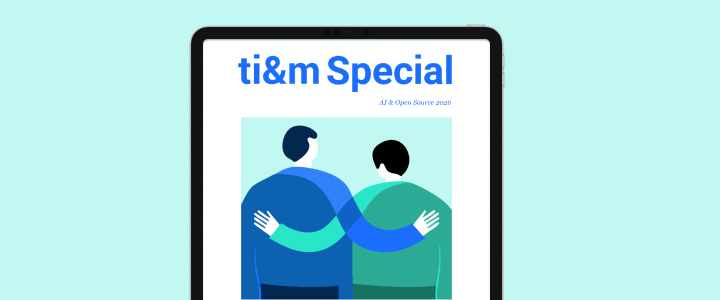«Manchmal entstehen aus Resten die besten Kunstwerke»
Flavio, dein Ausstellungstitel lautet «Verzweigte Sphären». Kannst du uns kurz erklären, was die Besucher erwartet?
Die Ausstellung besteht aus fragmentarischen Bildern, die mit komplexen, detailreichen Strukturen vielfältige Assoziationen wecken. Kleine Fehler und Fragilität sind Teil der Werke. Ausserdem gibt es eine Filminstallation, in denen beispielsweise Baumkronen gespiegelt oder Experimente mit gefrorener Tinte gezeigt werden. So werden verschiedene Verknüpfungen gesponnen zwischen diversen fraktalen Strukturen. Verzweigte Sphären sind überall auf die eine oder andere Art zu sehen.
Du arbeitest mit einer speziellen Guss-Technik. Wie funktioniert dieser Prozess?
Für die Güsse brauche ich eine glatte und feste Oberfläche. Die ausgestellten Werke wurden alle auf einem Spiegel gegossen. Zuvor male ich auf die Fläche, wobei besonders die Konsistenz der Farbe das spätere Bild beeinflusst. Hierfür benutze ich verschiedene schwarze Farben, die zwar ähnlich aussehen, aber sehr unterschiedlich auf die Giessmasse reagieren, die entweder aus Gips oder aus einer Calcium-Sulfat-Mischung besteht. Im Giessen entstehen Bewegungen, die festgehalten werden – Pigmente, die auseinanderdriften, sich auflösen und dabei auch an tektonische und sphärische Dynamiken erinnern.

Deine Technik klingt nach einer Mischung aus Kontrolle und Loslassen. Wie viel ist planbar, und wie viel überlässt du dem Zufall?
Es ist ein klassisches Experimentieren: Ich habe eine Vorstellung davon, wie bestimmte Bilder entstehen können, doch am Ende entwickeln sie sich oft ganz anders – manchmal enttäuschend, manchmal umso interessanter. Wenn etwas besonders gut ist, versuche ich mit möglichst gleicher Farbkonsistenz und Gusstechnik den Prozess zu wiederholen, was aber nur ansatzweise klappt, da schon kleinste Veränderungen zu grossen Unterschieden führen. Lustigerweise sind oft die Werke am besten, die nur entstanden sind, weil noch etwas Gips übrig war und ich spontan etwas Neues ausprobiert habe.
Deine Arbeiten erinnern an fraktale Strukturen, wie man sie aus der Natur oder auch der Mathematik kennt. Was fasziniert dich an Fraktalen?
Ich fand es schon immer interessant, dass mein Zugang zu Fraktalen über Intuition und Beobachtung entsteht, während Fraktale gleichzeitig etwas mathematisch Komplexes sind und in Computer-Hardware und Algorithmen gebraucht werden. Fraktale sind überall um uns, sogar in uns, und trotzdem werden die Verwandtschaften dieser Strukturen kaum gesehen.

Gibt es für dich eine Verbindung zwischen deinen Kunstwerken und digitalen Themen wie Informatik oder Netzwerken?
Im Digitalen wird Hochkomplexes oft simpel und clean verpackt. Bei mir wird die Komplexität eher offengelegt, was manchmal chaotisch wirkt, aber trotzdem einer grundlegenden Ordnung folgt. So entstehen gerade im Ästhetischen zahlreiche Verbindungen zu Netzwerken und Datenstrukturen, die ja auch teilweise in Form von Bäumen angeordnet werden. Es gibt Knoten, Pfade, Schnittstellen und eben auch Verzweigungen.

An den Vernissagen werden auch Filme zu sehen sein. Welche Rolle spielt das bewegte Bild in der Ausstellung und in deiner Arbeit allgemein?
So schön es ist, Dinge festzuhalten, ist es manchmal einfach schöner, sie in Bewegung zu bringen, weswegen ich seit vier Jahren vermehrt mit Filminstallationen arbeite. Die Filme entstehen meist auf experimenteller, spielerischer Basis und einer fast schon naiven Offenheit. So lasse ich mich mit der Filmkamera treiben und entdecke dadurch umso mehr. Dies gibt dem Ganzen etwas Rohes, was später aber mit viel Sorgfalt zusammengefügt und installiert wird.
Was bedeutet Kunst für dich?
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass unsere Wahrnehmung grundlegend dafür ist, wie wir leben, wie wir entscheiden und wie sich unser Weltbild entwickelt. Und trotzdem setzen wir uns kaum mit unseren Sinnen auseinander. Wir bekommen von der Welt nur das mit, wofür wir empfänglich sind. Da unsere Wahrnehmungsfilter zufällig sind, können wir sie uns bewusst machen, ergänzen, ändern oder ersetzen, wenn wir das wollen. Wer lernen möchte zu sehen, ohne auch gleich erkennen zu müssen, kann sich dem aussetzen, was nicht schon vorgefiltert ist. Wir brauchen also die Begegnung mit dem Anderen, die Begegnung mit Dingen, die sich vom Alltagstrott abgrenzen. Zum Beispiel die Begegnung mit Kunst.